Im Laufe der 125 Jahre des Schützenvereins Wimbern hat es mehrere Satzungen und Satzungsänderungen gegeben:
- 1893: Die Gründungssatzung
- 1937: Die Einheitssatzung in der NS-Zeit
- 1950: Die neue Satzung nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2016: Die aktuelle Satzung, zuletzt geändert in den Generalversammlungen 1994 und 2005
Die vier Satzungen entstanden jeweils unter dem Einfluss der politischen Situation in Deutschland. Dieser Vergleich stellt wesentliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten heraus.
Während die Gründungssatzung (1893), die neue Satzung nach dem Krieg (1950) und die aktuelle Satzung in demokratischer und freier Willensbildung von den Mitgliedern beschlossen wurden, wurde die Einheitssatzung dem Verein vom NS-Staat aufgezwungen.
Am 13. Juni 1937 wurde in einer außerordentlichen Generalversammlung die neue Einheitssatzung des Nazi-Regimes eingeführt. Im Archiv der Stadt Menden und in den Protokollbüchern des Schützenvereins Wimbern liegt dieses Dokument nicht mehr vor. So steht es noch in der Chronik von 1991.
Inzwischen konnte der Wortlaut dieser Einheitssatzung mit Hilfe des Bürgerschützenbundes Menden beschafft werden. Da die nationalsozialistische Einheitssatzung für alle Vereine verbindlich war, galt die entsprechende Zweckbestimmung auch für den Wimberner Schützenverein.
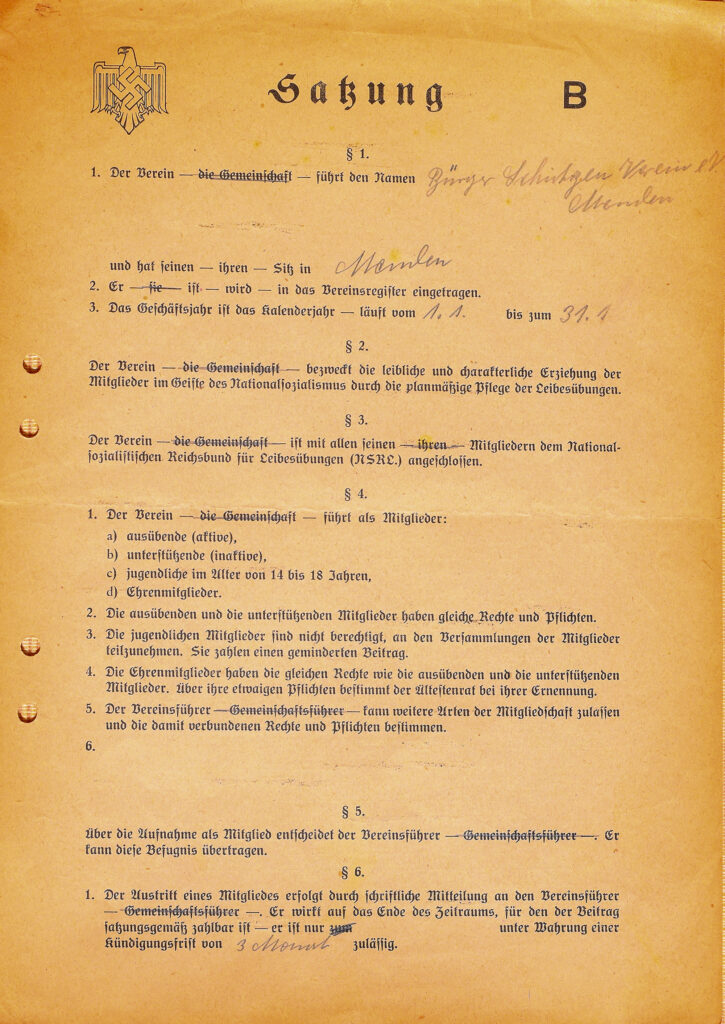
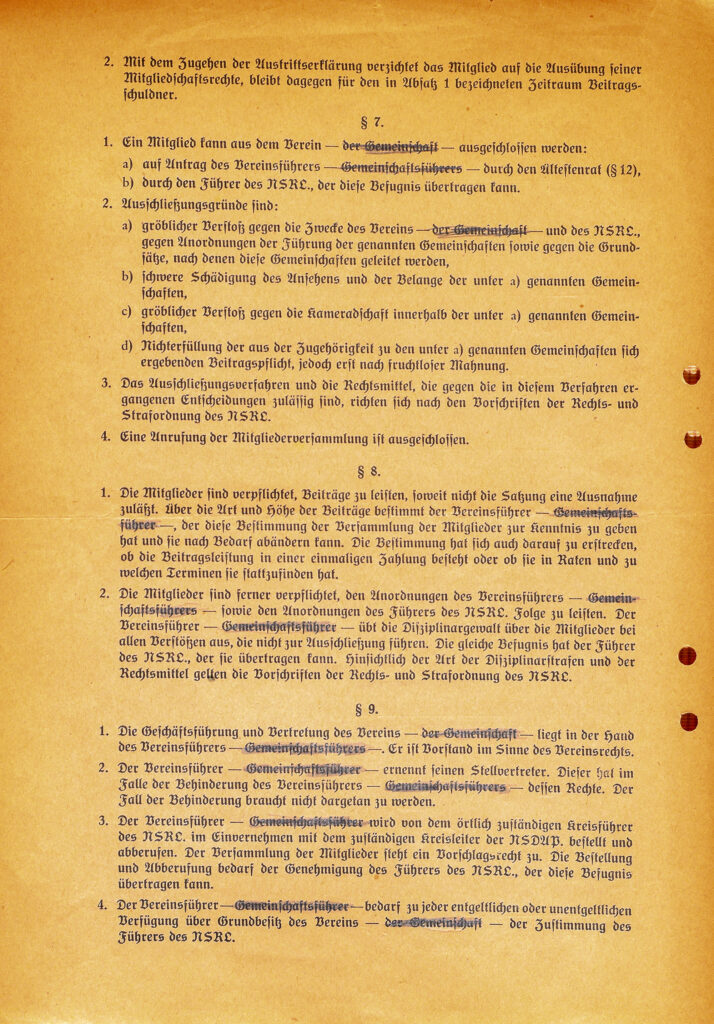
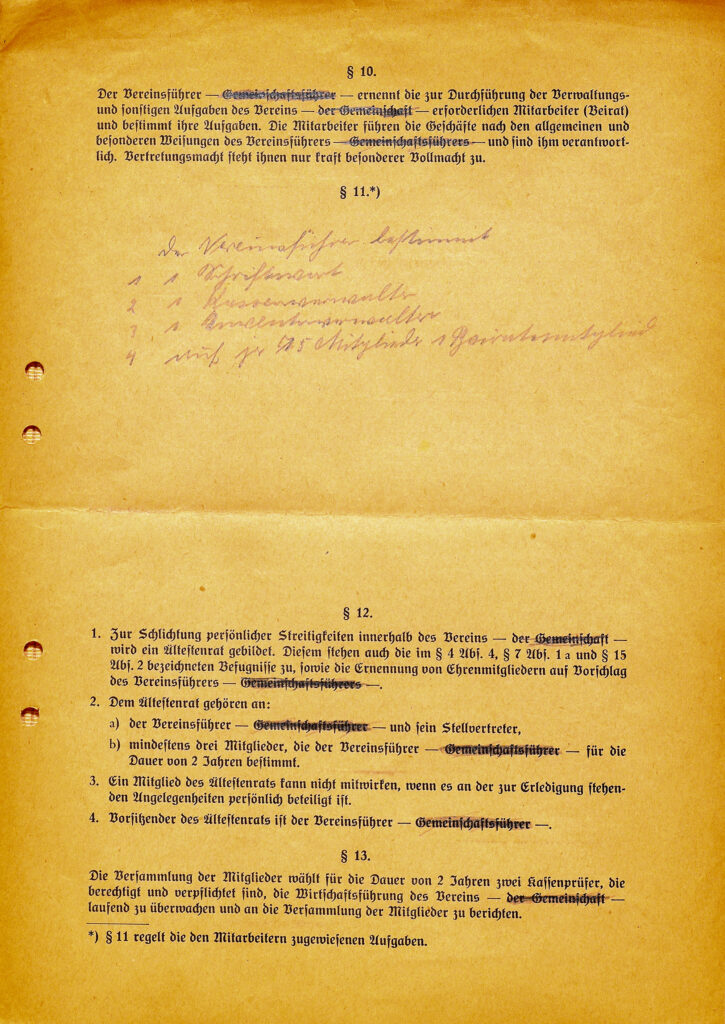
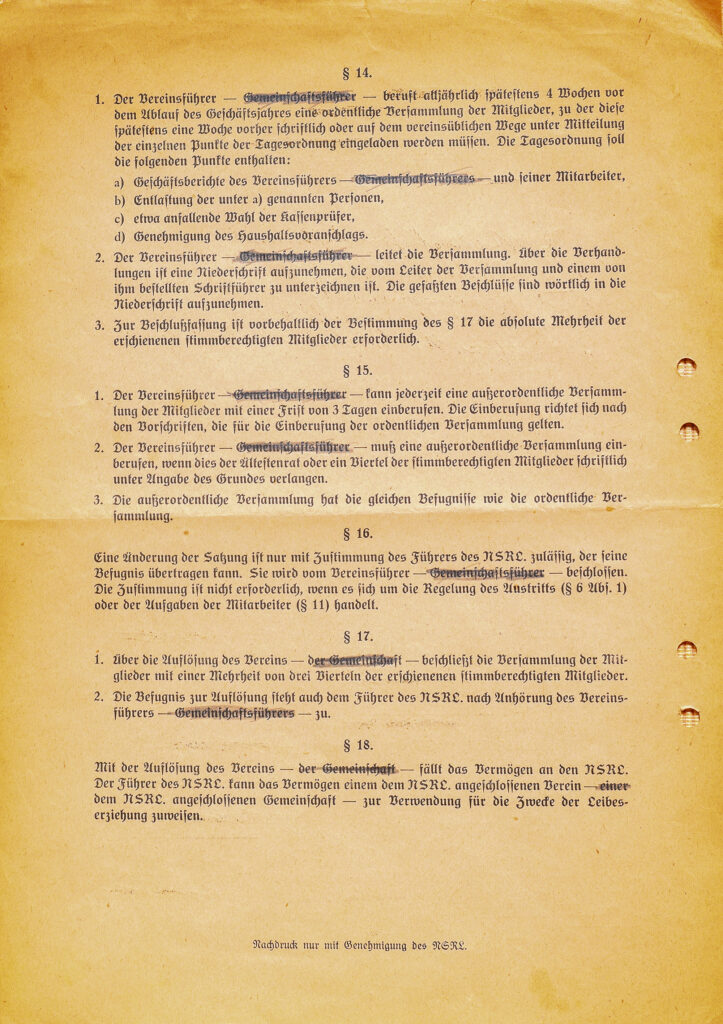
Ein weitergehender geschichtlicher und sozialwissenschaftlicher Vergleich der einzelnen Paragrafen der verschiedenen Satzungen ist sicherlich eine interessante und lohnenswerte Aufgabe, würde aber in dieser Chronik den Rahmen sprengen.
Auffallend für die drei selbstbestimmten Satzungen ist, dass sie im Laufe der Geschichte in der Zahl der Paragrafen und in den Formulierungen immer umfangreicher und detaillierter wurden:
- 1893: 8 Paragrafen und 338 Wörter
- 1950: 11 Paragrafen und 813 Wörter
- 2016: 22 Paragrafen und 1513 Wörter
Wesentliche Paragrafen der verschiedenen Satzungen sind:
- Wesen und Aufgabe des Schützenvereins
- Mitgliedschaft
- Aufgaben des Vorstandes
Auf diese Punkte konzentriert sich der hier vorgestellte Vergleich.
Bereits beim Punkt „Wesen und Aufgabe des Schützenvereins“ werden große Unterschiede deutlich.
…eine Gesellschaft, welche es sich zur Aufgabe macht, Eintracht, Geselligkeit und Frohsinn in geeigneter Weise zu beleben und die Liebe für Kaiser und Vaterland zu erhalten und zu befestigen.
1893
Zum Schießsport ist an keiner Stelle in der gesamten Satzung etwas zu finden.
Der Verein bezweckt die leibliche und charakterliche Erziehung seiner Mitglieder und Pflege des Volksbewusstseins im Geiste des Nationalsozialismus. … Der Verein bezweckt Pflege des Schiessens, des Schiesssportes und des Schützenwesens im Dienste der allgemeinen Ziele des Staates und im Sinne der vom Reichssportführer geleiteten deutschen Sportbewegung.
1937
Viel krasser könnte der Unterschied der nationalsozialistischen Einheitssatzung im Vergleich zur Gründungssatzung kaum sein. Oberstes Ziel ist nun die Erziehung der Mitglieder im Geist des Nationalsozialismus.
Der individuelle, lebensfrohe, gesellige Ansatz der Gründungssatzung und die Liebe zum Vaterland finden sich nicht wieder. Stattdessen wird der Dienst für die Ziele des Staates eingefordert.
Neu hinzu kommt die Ausrichtung auf den Schießsport. Tatsächlich steckt dahinter das Ziel einer paramilitärischen Ausbildung mit Blick auf die Kriegsvorbereitungen.
… ist die St. Johannes Schützenbruderschaft Wimbern bestrebt, …
- die Pflege des religiösen Lebens, insbesondere die Verehrung des allerheiligsten Altarsakraments und die Heilighaltung des Sonntags zu fördern,
- die Werke der christlichen Nächstenliebe zu üben,
- an die Bildung und Erhaltung eines gesunden Volkstums auf der Grundlage christlicher Sitte mit zu arbeiten und
- für die staatsbürgerliche Erziehung nach den Grundsätzen der kath. Weltanschauung tätig zu sein.
1950
Praktisch kein Gedanke der nationalsozialistischen Einheitssatzung findet sich hier wieder. Die „dunklen Jahre“ der deutschen Geschichte sind überwunden. Allerdings wird auch die frohgestimmte und gesellige Aufgabenstellung der Gründungssatzung aus dem Jahre 1893 nicht mehr benannt, stattdessen treten zum einen religiöse Aspekte und zum anderen Werte wie christliche Nächstenliebe, Erhaltung eines gesunden Volkstums sowie die staatsbürgerliche Erziehung in den Vordergrund.
Die St. Johannes Schützenbruderschaft ist eine Vereinigung von Männern, deren Mitglieder sich getreu dem Wahlspruch „Für Glaube, Sitte, Heimat“ folgende Aufgaben stellen:
- Bekenntnis des Glaubens durch
- aktive religiöse Lebensführung,
- Ausgleich sozialer und konfessioneller Spannungen im Geiste echter Brüderlichkeit,
- Werke christlicher Nächstenliebe.
- Schutz der Sitte durch
- Eintreten für christliche Sitte und Kultur im privaten und öffentlichen Leben,
- Gestaltung echter brüderlicher Geselligkeit.
- Liebe zur Heimat durch
- Dienst für das Gemeinwohl aus
- verantwortungsbewusstem Bürgersinn,
- tätige Nachbarschaftshilfe,
- Pflege der geschichtlichen Überlieferung und des althergebrachten Brauchtums.
- Nichtkatholische Mitglieder verpflichten sich mit der Aufnahme in die Bruderschaft grundsätzlich, deren christliche Grundsätze zu achten.
2016
Hier wird die Ausrichtung des Vereins getreu dem Motto „Glaube, Sitte, Heimat“ deutlich und als Aufgabe konkret beschrieben. Die Aspekte der christlichen Religion, echter Brüderlichkeit und Nächstenliebe aus der vorherigen Satzung tauchen hier ebenfalls wieder auf.
Die staatsliebenden Aspekte der freien, vorherigen Satzungen (1893: Liebe für Kaiser und Vaterland; 1950: Staatsbürgerliche Erziehung) werden nicht mehr explizit angegeben, finden aber eine Entsprechung im verantwortungsbewussten Bürgersinn, der zur Aufgabe aller Mitglieder gehört.
Der ursprünglich weit und groß gefasste staatliche Gedanke wird konkret auf die einzelne staatliche Gemeinschaft im Kleinen heruntergebrochen. Staatsphilosophisch wird ein „Wir feiern, um die Vaterlandsliebe zu erhalten“ zu „Verantwortungsbewusstsein für die Gemeinschaft“.
Auch beim Punkt „Mitgliedschaft“ weisen die vier miteinander verglichenen Satzungen große Unterschiede auf.
Mitglied des Vereins kann jeder werden, der in Wimbern oder einer der angrenzenden Ortschaften wohnt, das 18. Lebensjahr erreicht hat und in Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist.
1893
Der Verein führt als Mitglieder:
- ausübende (aktive),
- unterstützende (inaktive)
- jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren,
- Ehrenmitglieder
Über die Aufnahme als Mitglied entscheidet der Vereinsführer.
Der Verein ist mit all seinen Mitgliedern dem Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen (NSRL) angeschlossen.
1937
Mitglied kann jede männliche Person werden, die unbescholten ist, sich auf das Programm der Bruderschaft verpflichtet und das 18. Lebensjahr erreicht hat. Aus der Kirche ausgetretene Personen oder in ihrem Familienleben z.B. durch Trunksucht oder Ehescheidung belastete Personen können nicht aufgenommen werden.
1950
Mitglied kann jede unbescholtene Person werden, die das 16.Lebensjahr vollendet hat und bereit ist, sich dieser Satzung zu verpflichten. … Die St. Johannes Schützenbruderschaft ist eine Vereinigung von Männern.
2016
Auch hinsichtlich der Mitgliedschaft fallen einige Veränderungen im Laufe der Jahre auf:
- In den frühen Satzungen müssen Mitglieder das 18. Lebensjahr erreicht haben, die Einheitssatzung von 1937 greift schon auf 14-Jährige zurück, in der aktuellen Satzung der Bruderschaft muss ein Mitglied das 16. Lebensjahr vollendet haben.
- Die erste Satzung von 1893 verweist ausdrücklich auf den örtlichen Rahmen Wimberns und angrenzender Ortschaften. In den späteren Satzungen findet sich diese räumliche Einschränkung nicht mehr.
- In der Satzung von 1950 werden konkret Verhaltensweisen (Kirchenaustritt, Trunksucht und Ehescheidung) angesprochen, die einer Mitgliedschaft entgegenstehen. In der aktuellen Fassung fehlen diese Einschränkungen völlig.
- Allen selbstbestimmten Satzungen gemeinsam ist, dass nur unbescholtene Männer Mitglied werden können beziehungsweise im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sein müssen. In der Zwangssatzung von 1937 gibt es keine Aussagen zur charakterlichen Eignung der Mitglieder.
- Interessant auch, dass in den beiden letzten Satzungen nochmals ausdrücklich betont wird, dass der Schützenverein Wimbern nur Männer als Mitglieder zulässt.
Der letzte zu vergleichende Aspekt der unterschiedlichen Satzungen beschäftigt sich mit den „Aufgaben des Vorstandes“. In den drei selbstbestimmten Satzungen trägt der demokratisch gewählte Vorstand die Verantwortung für den Verein und vertritt ihn nach innen und außen. In der Einheitssatzung von 1937, die der politischen Gleichschaltung und dem Führerprinzip Rechnung trägt, liegt
…die Geschäftsführung und Vertretung in der Hand des Vereinsführers. Er ist Vorstand im Sinne des Vereinsrecht.
Neben der Beschreibung der vielfältigen Tätigkeiten finden sich nahezu wortgleich in den drei selbstbestimmten Satzungen auch noch: Der Vorstand
…wacht über die Beachtung der Statuten und Aufrechterhaltung der Ordnung und des Anstandes.
Es wird deutlich, wie sehr die Satzungen jeweils historische Spiegel der staatlichen und gesellschaftlichen Bedingungen sind. Während die Gründungssatzung dem Verein eine vaterländisch-monarchistische Ausrichtung gibt, setzt die zweite Satzung im Zuge der sogenannten Gleichschaltung militaristisch-nationalsozialistische Akzente. Erst die deutliche und für den Verein neue kirchliche Orientierung schaffte die Voraussetzung für die Freigabe des Vereinsvermögens und die Wiederzulassung als Schützenbruderschaft nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die aktuelle Satzung, die zuletzt in den Jahren 1994 und 2005 geändert wurde, schließlich ist getragen von einem bürgerschaftlich-demokratischen Gesellschaftsbild.